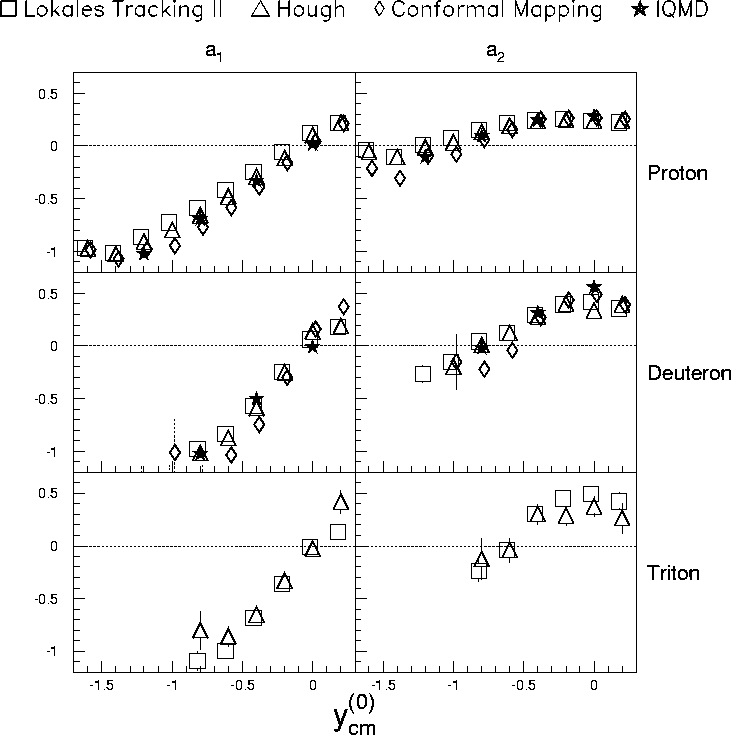
Abbildung: Extrahierte Flußparameter für Baryonen bei PM3: Die Parametrisierung der azimutalen Verteilungen erfolgte nach Gleichung 4.2. Die auf die Ungenauigkeit der Reaktionsebenenbestimmung korrigierten Parameter
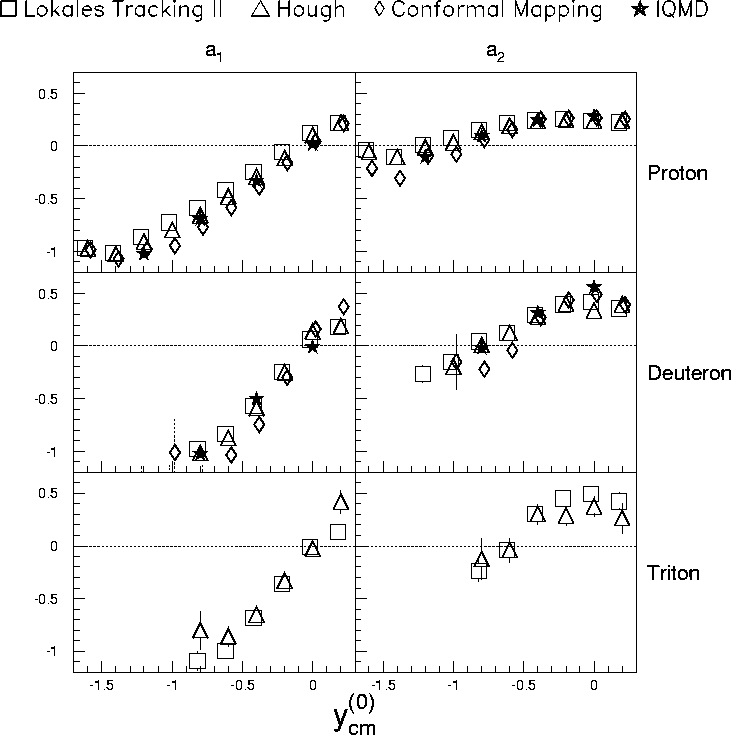
Abbildung:
Extrahierte Flußparameter für Baryonen bei PM3: Die Parametrisierung der
azimutalen Verteilungen erfolgte nach Gleichung 4.2. Die
auf die Ungenauigkeit der Reaktionsebenenbestimmung korrigierten
Parameter ![]() und
und ![]() sind für die
verschiedenen eingesetzten Tracking-Programme und für das IQMD-Modell
dargestellt. Aufgrund mangelnder Statistik können die Deuteronen und
Tritonen nicht über den gesamten Rapiditätsbereich gezeigt werden.
Die Fehlerbalken geben nur den statistischen Fehler wieder. Aus den
Unterschieden
zwischen den einzelnen Tracking-Programmen läßt sich aber der systematische
Fehler abschätzen.
Die Daten
werden im Rahmen dieser Fehler durch das Modell sehr gut reproduziert.
sind für die
verschiedenen eingesetzten Tracking-Programme und für das IQMD-Modell
dargestellt. Aufgrund mangelnder Statistik können die Deuteronen und
Tritonen nicht über den gesamten Rapiditätsbereich gezeigt werden.
Die Fehlerbalken geben nur den statistischen Fehler wieder. Aus den
Unterschieden
zwischen den einzelnen Tracking-Programmen läßt sich aber der systematische
Fehler abschätzen.
Die Daten
werden im Rahmen dieser Fehler durch das Modell sehr gut reproduziert.
Weil in dieser Arbeit die Flußeffekte der Pionen im Vordergrund stehen,
wird für einen Modellvergleich das IQMD-Modell [Har93, Bas93a]
herangezogen. Es behandelt explizit die Pionenproduktion über die
![]() -Resonanz.
Die folgenden Prozesse werden im Modell berücksichtigt:
-Resonanz.
Die folgenden Prozesse werden im Modell berücksichtigt:
Für diesen Vergleich wurden die experimentellen Flußparameter
![]() und
und ![]() mit den in Tabelle 4.2 angegebenen
Faktoren korrigiert. Eine Abschätzung des systematischen
Fehlers ergibt sich aus der Verwendung der drei verschiedenen
Tracking-Programme, die, wie in Kapitel 3.2 erläutert,
mit grundverschiedenen Ansätzen arbeiten.
Mit Hilfe der in Kapitel 3.3
vorgestellten Simulationen wurde die in Abbildung 4.2 unten
gezeigte Einteilung in PM-Klassen für die Modelldaten vorgenommen.
Die Modelldaten wurden sowohl durch einen geometrischen als auch
durch einen zweidimensionalen Schnitt in der
Transversalimpuls-Rapiditäts Verteilung an die Detektorakzeptanz angepaßt.
mit den in Tabelle 4.2 angegebenen
Faktoren korrigiert. Eine Abschätzung des systematischen
Fehlers ergibt sich aus der Verwendung der drei verschiedenen
Tracking-Programme, die, wie in Kapitel 3.2 erläutert,
mit grundverschiedenen Ansätzen arbeiten.
Mit Hilfe der in Kapitel 3.3
vorgestellten Simulationen wurde die in Abbildung 4.2 unten
gezeigte Einteilung in PM-Klassen für die Modelldaten vorgenommen.
Die Modelldaten wurden sowohl durch einen geometrischen als auch
durch einen zweidimensionalen Schnitt in der
Transversalimpuls-Rapiditäts Verteilung an die Detektorakzeptanz angepaßt.
Die Parametrisierung der experimentellen und modellierten azimutalen Verteilungen der Baryonen bei PM3 und PM5 sind in Abbildung 5.1 und 5.2 gezeigt. Die Resultate, die mit den verschiedenen Tracking-Programmen erzielt werden, zeigen eine sehr gute Übereinstimmung untereinander. Wegen mangelnder Statistik können die Deuteronen und Tritonen nicht über den gesamten Rapiditätsbereich gezeigt werden.
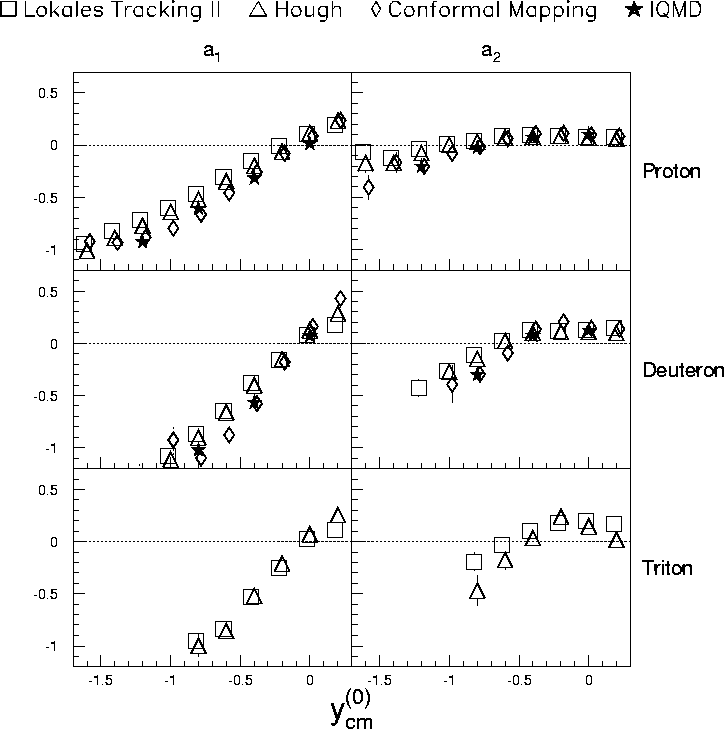
Abbildung:
Extrahierte Flußparameter für Baryonen bei PM5:
Wie in Abbildung 5.1 stimmen die Modelldaten
mit den experimentellen Daten gut überein. Allerdings zeigen
die experimentellen Daten eine stärkere Änderung in der ![]() -Komponente
beim Übergang von PM3 zu PM5.
-Komponente
beim Übergang von PM3 zu PM5.
Die ![]() -Komponente
ist bei Midrapidität für Protonen und Deuteronen leicht positiv,
was daraufhin deutet, daß es hier schwache Verluste in der
Reaktionsebene gibt. Der Fluß in die Reaktionsebene wird vom
IQMD-Modell sowohl bei PM3 als auch bei PM5
sehr gut reproduziert. Der Unterschied in der
-Komponente
ist bei Midrapidität für Protonen und Deuteronen leicht positiv,
was daraufhin deutet, daß es hier schwache Verluste in der
Reaktionsebene gibt. Der Fluß in die Reaktionsebene wird vom
IQMD-Modell sowohl bei PM3 als auch bei PM5
sehr gut reproduziert. Der Unterschied in der ![]() -Komponente
zwischen PM3 und PM5 ist aber in den experimentellen Daten
größer als im Modell.
Für einen Vergleich der Flußeffekte von
Tritonen stand keine ausreichende Statistik an Modelldaten zur
Verfügung
-Komponente
zwischen PM3 und PM5 ist aber in den experimentellen Daten
größer als im Modell.
Für einen Vergleich der Flußeffekte von
Tritonen stand keine ausreichende Statistik an Modelldaten zur
Verfügung .
.
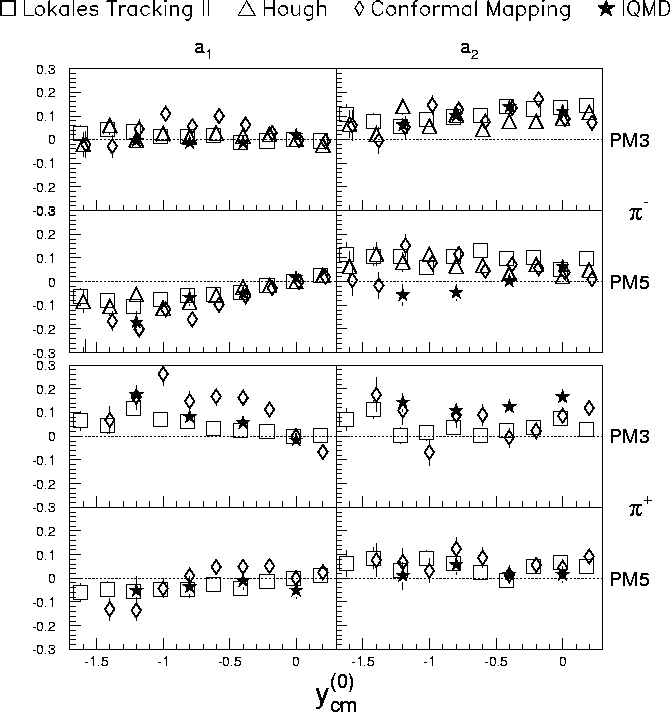
Abbildung:
Extrahierte Flußparameter für Pionen:
Die Probleme mit den Pionen spiegeln sich in den größeren Unterschieden
zwischen den Tracking-Programmen wider. Die Trends sind dennoch eindeutig.
Negative Pionen zeigen in peripheren Stößen keinen ausgezeichneten
Fluß in die Reaktionsebene. In zentralen Stößen tritt ein zu den Baryonen
korrelierter Fluß in die Reaktionsebene auf. Positive Pionen zeigen in
peripheren Stößen eine Antikorrelation zum Fluß der Baryonen. Dieses
Flußverhalten kehrt sich in zentralen Stößen um.
Die Daten werden im Rahmen der systematischen Fehler vom IQMD-Modell
gut reproduziert. Lediglich die Emission positiver Pionen
senkrecht zur Reaktionsebene in peripheren Stößen wird überschätzt.
Auch ist die Fokussierung der negativen Pionen in die Reaktionsebene
in zentralen Stößen nicht so stark ausgeprägt.
In Abbildung 5.3 sind die extrahierten Flußparameter der
Pionen für PM3 und PM5 dargestellt. Aufgrund der
größeren systematischen Fehler, die sich durch den Einsatz
verschiedener Tracking-Programme abschätzen lassen,
streuen die Werte stärker als
bei den Baryonen .
Trends lassen sich zumindest qualitativ dennoch ablesen:
.
Trends lassen sich zumindest qualitativ dennoch ablesen:
In peripheren Kollisionen zeigen negative Pionen im IQMD-Modell
bei allen Rapiditäten keine Flußkomponente ![]() in die Reaktionsebene.
Die Daten zeigen ein ähnliches Verhalten,
eine Andeutung einer Antikorrelation. Der ''Squeeze-Out'', der sich in
der
in die Reaktionsebene.
Die Daten zeigen ein ähnliches Verhalten,
eine Andeutung einer Antikorrelation. Der ''Squeeze-Out'', der sich in
der ![]() -Komponente zeigt wird in der richtigen Höhe wiedergegeben.
Auch daß die bevorzugte Emission
in allen Rapiditätsbereichen senkrecht zur Reaktionsebene stattfindet,
wird im Modell reproduziert.
In zentraleren Kollisionen weisen negative Pionen sowohl im Modell
als auch in den experimentellen Daten eine Korrelation mit dem
Nukleonenfluß in die Reaktionsebene auf. Aber die im Modell
durch die negativen
-Komponente zeigt wird in der richtigen Höhe wiedergegeben.
Auch daß die bevorzugte Emission
in allen Rapiditätsbereichen senkrecht zur Reaktionsebene stattfindet,
wird im Modell reproduziert.
In zentraleren Kollisionen weisen negative Pionen sowohl im Modell
als auch in den experimentellen Daten eine Korrelation mit dem
Nukleonenfluß in die Reaktionsebene auf. Aber die im Modell
durch die negativen ![]() -Werte vorhergesagte
Fokussierung in die Reaktionsebene läßt sich aus den Daten nicht
ablesen.
-Werte vorhergesagte
Fokussierung in die Reaktionsebene läßt sich aus den Daten nicht
ablesen.
Die Streuung der Werte ist bei positiven Pionen größer als bei negativen.
Zudem ist die Hough-Transformation wegen
der in Kapitel 3.3 beschriebenen Probleme für positive Pionen
nicht einsetzbar. Trotzdem
läßt sich in peripheren Kollisionen eine klare Antikorrelation zum
Fluß der Baryonen in die Reaktionsebene sehen, die vom Modell
beschrieben wird. Das ''Squeeze-Out'' Verhalten ist aber in den Daten
erheblich schwächer als im Modell. In zentralen Stößen kehrt sich
der Fluß der positiven Pionen um und korreliert mit dem Fluß der Baryonen.
Auch die ![]() -Komponente stimmt im Rahmen der Fehler überein.
-Komponente stimmt im Rahmen der Fehler überein.
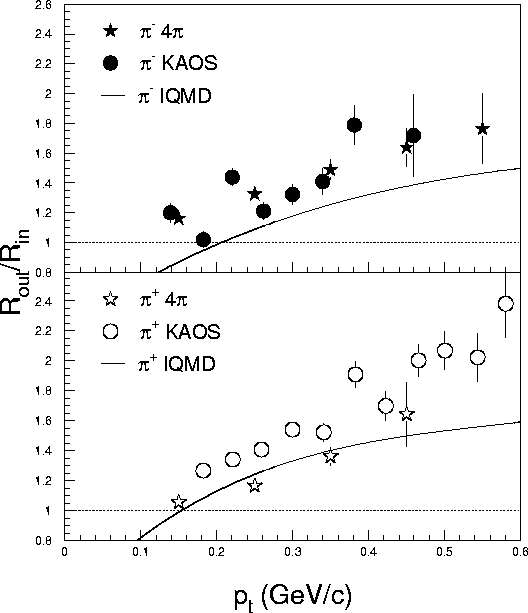
Abbildung:
R ![]() /R
/R ![]() bei Midrapidität für Pionen als Funktion des
Transversalimpulses, Vergleich mit KAOS und IQMD:
Die Daten des 4
bei Midrapidität für Pionen als Funktion des
Transversalimpulses, Vergleich mit KAOS und IQMD:
Die Daten des 4 ![]() -Detektors zeigen für negative Pionen
eine gute Übereinstimmung mit den Daten des Kaonenspektrometers KAOS.
Für positive Pionen zeigen die Daten des 4
-Detektors zeigen für negative Pionen
eine gute Übereinstimmung mit den Daten des Kaonenspektrometers KAOS.
Für positive Pionen zeigen die Daten des 4 ![]() -Detektors eine
schwächere Emission senkrecht zur Reaktionsebene an.
Im Gegensatz zum IQMD-Modell deuten die Daten eine lineare Abhängigkeit
vom Transversalimpuls an. Auch unterschätzt das Modell das
Verhalten der negativen Pionen.
-Detektors eine
schwächere Emission senkrecht zur Reaktionsebene an.
Im Gegensatz zum IQMD-Modell deuten die Daten eine lineare Abhängigkeit
vom Transversalimpuls an. Auch unterschätzt das Modell das
Verhalten der negativen Pionen.
Die Transversalimpulsabhängigkeit des Pionenflusses
senkrecht zur Reaktionsebene bei Midrapidität
ist in Abbildung 5.4 für PM3 gezeigt. Zum Vergleich
wurden neben der theoretischen Kurve aus dem IQMD-Modell [Bas93b]
auch existierende experimentelle Daten des Kaonenspektrometers
KAOS [Sen93] eingezeichnet.
Die Pionendaten von KAOS wurden auf die
angegebene Unsicherheit der Reaktionsebenenrekonstruktion von
wurden auf die
angegebene Unsicherheit der Reaktionsebenenrekonstruktion von
![]() korrigiert. Der Multiplizitätsbereich
MUL2-MUL3 entspricht einer peripheren
Stoßparameterselektion [Bri93b].
korrigiert. Der Multiplizitätsbereich
MUL2-MUL3 entspricht einer peripheren
Stoßparameterselektion [Bri93b].
Die Messungen des 4 ![]() -Detektors stimmen mit den Daten von KAOS
für negative Pionen gut überein. Das Verhältnis
-Detektors stimmen mit den Daten von KAOS
für negative Pionen gut überein. Das Verhältnis ![]() wird
durch das Modell unterschätzt. Vor allem der vorhergesagte Übergang
von einer bevorzugten Emission senkrecht zur Reaktionsebene zu einer
Emission in die Reaktionsebene läßt sich
weder für negative noch für positive Pionen beobachten. Für positive
Pionen ist die Übereinstimmung zwischen dem 4
wird
durch das Modell unterschätzt. Vor allem der vorhergesagte Übergang
von einer bevorzugten Emission senkrecht zur Reaktionsebene zu einer
Emission in die Reaktionsebene läßt sich
weder für negative noch für positive Pionen beobachten. Für positive
Pionen ist die Übereinstimmung zwischen dem 4 ![]() -Detektor und KAOS
nicht ganz so gut. Die Daten des 4
-Detektor und KAOS
nicht ganz so gut. Die Daten des 4 ![]() -Detektors liegen etwas niedriger,
entsprechen aber im Rahmen der statistischen Fehler
der Vorhersage des IQMD-Modells. Die KAOS-Daten werden dagegen
unterschätzt. Auch legen diese Daten einen eher linearen Verlauf
der Kurve nahe.
-Detektors liegen etwas niedriger,
entsprechen aber im Rahmen der statistischen Fehler
der Vorhersage des IQMD-Modells. Die KAOS-Daten werden dagegen
unterschätzt. Auch legen diese Daten einen eher linearen Verlauf
der Kurve nahe.
Im IQMD-Modell ist es möglich, die eingangs erwähnten Prozesse der
Deltaproduktion und -Absorption zu aktivieren bzw. deaktivieren. Auf
diese Weise können die Einflüsse der einzelnen Kanäle auf die
Flußeffekte der Pionen studiert werden. Bei Unterdrückung der
Pionenabsorption ![]() N
N ![]()
![]() wurde kein ''Squeeze-Out''
beobachtet [Bas93b]. Daraus würde sich
die Absorption in Kernmaterie als der Mechanismus darstellen, der
zur bevorzugten Emission senkrecht zur Reaktionsebene führt. Danach würde
das unterschiedliche Flußverhalten der geladenen Pionen beim Übergang
von peripheren zu zentralen Kollisionen durch die verschiedene Menge an
Spektatorenmaterie erklärt. Das ursprüngliche Flußverhalten
der Pionen wäre demnach in zentralen Ereignissen zu beobachten, wo sie
den Fluß der
wurde kein ''Squeeze-Out''
beobachtet [Bas93b]. Daraus würde sich
die Absorption in Kernmaterie als der Mechanismus darstellen, der
zur bevorzugten Emission senkrecht zur Reaktionsebene führt. Danach würde
das unterschiedliche Flußverhalten der geladenen Pionen beim Übergang
von peripheren zu zentralen Kollisionen durch die verschiedene Menge an
Spektatorenmaterie erklärt. Das ursprüngliche Flußverhalten
der Pionen wäre demnach in zentralen Ereignissen zu beobachten, wo sie
den Fluß der ![]() -Resonanzen widerspiegeln, der, da es sich um
angeregte Nukleonen handelt, mit dem Nukleonenfluß korreliert sein sollte.
Dieser Effekt wird in den zentralen PM5-Ereignissen beobachtet.
Durch die Anwesenheit größerer Mengen an Spektatorenmaterie in
peripheren Stößen werden diese Pionen absorbiert.
Damit beruht der ''Squeeze-Out'' der Pionen nicht auf einer Kompression
der Kernmaterie wie der Squeeze-Out der Nukleonen.
Aus der Stärke
dieses Effektes bei Pionen läßt sich somit keine Aussage über die
Kompressibilität von Kernmaterie ableiten. Er ist aber ein Maß für
die Absorption von Pionen in Kernmaterie.
-Resonanzen widerspiegeln, der, da es sich um
angeregte Nukleonen handelt, mit dem Nukleonenfluß korreliert sein sollte.
Dieser Effekt wird in den zentralen PM5-Ereignissen beobachtet.
Durch die Anwesenheit größerer Mengen an Spektatorenmaterie in
peripheren Stößen werden diese Pionen absorbiert.
Damit beruht der ''Squeeze-Out'' der Pionen nicht auf einer Kompression
der Kernmaterie wie der Squeeze-Out der Nukleonen.
Aus der Stärke
dieses Effektes bei Pionen läßt sich somit keine Aussage über die
Kompressibilität von Kernmaterie ableiten. Er ist aber ein Maß für
die Absorption von Pionen in Kernmaterie.
Dagegen wird der Fluß in die Reaktionsebene durch Streuung der Pionen
an der Spektatorenmaterie verursacht,
wie eine Deaktivierung der Deltaabsorption ![]() N
N ![]() NN zeigte.
Durch diese Deaktivierung wird lediglich
die Pionenabsorption nicht aber die Pionenstreuung
unterdrückt
NN zeigte.
Durch diese Deaktivierung wird lediglich
die Pionenabsorption nicht aber die Pionenstreuung
unterdrückt .
Der Grund für die Antikorrelation beim Fluß in die Reaktionsebene
in peripheren Ereignissen wäre demnach eine Rückstreuung der Pionen
an der vorhandenen Spektatorenmaterie. Durch die Coulomb-Wechselwirkung
zeigt sich dieser Effekt für positive Pionen stärker als für negative,
da letztere von den Nukleonen der Spektatorenmaterie angezogen werden, während
positive Pionen abgestoßen werden.
.
Der Grund für die Antikorrelation beim Fluß in die Reaktionsebene
in peripheren Ereignissen wäre demnach eine Rückstreuung der Pionen
an der vorhandenen Spektatorenmaterie. Durch die Coulomb-Wechselwirkung
zeigt sich dieser Effekt für positive Pionen stärker als für negative,
da letztere von den Nukleonen der Spektatorenmaterie angezogen werden, während
positive Pionen abgestoßen werden.
Trotz dieser anders gearteten Mechanismen, die das Flußverhalten der Pionen
bestimmen, zeigen sie eine von den
Baryonen bekannte Transversalimpulsabhängigkeit
der Stärke des ''Squeeze-Out''.
Pionen, die senkrecht zur Reaktionsebene emittiert werden, werden weniger oft
gestreut und behalten auf diese Weise ihren ursprünglichen Transversalimpuls.
In die Reaktionsebene emittierte Pionen werden dagegen häufiger gestreut
und verlieren dadurch Energie. Die unter 90 ![]() /270
/270 ![]() emittierten
hochenergetischen Pionen geben deshalb ähnlich wie die Baryonen das
am wenigsten verfälschte Bild über die heiße Reaktionszone wieder.
Allerdings konnte der im Modell vorhergesagte
Übergang in eine bevorzugte Emission in die Reaktionsebene bei
Transversalimpulsen unterhalb von 200MeV/c in den Daten nicht gefunden
werden.
Die unterschiedliche Stärke der Emission senkrecht zur Reaktionsebene
stammt von der Coulomb-Wechselwirkung. Bezüglich des
Unterschieds zwischen positiven und negativen Pionen
gibt es aber einen Widerspruch zwischen den Messungen von
KAOS und dem 4
emittierten
hochenergetischen Pionen geben deshalb ähnlich wie die Baryonen das
am wenigsten verfälschte Bild über die heiße Reaktionszone wieder.
Allerdings konnte der im Modell vorhergesagte
Übergang in eine bevorzugte Emission in die Reaktionsebene bei
Transversalimpulsen unterhalb von 200MeV/c in den Daten nicht gefunden
werden.
Die unterschiedliche Stärke der Emission senkrecht zur Reaktionsebene
stammt von der Coulomb-Wechselwirkung. Bezüglich des
Unterschieds zwischen positiven und negativen Pionen
gibt es aber einen Widerspruch zwischen den Messungen von
KAOS und dem 4 ![]() -Detektor. Die Daten des 4
-Detektor. Die Daten des 4 ![]() -Detektors zeigen
bei Transversalimpulsen bis 400MeV/c
einen stärkeren ''Squeeze-Out'' Effekt für negative Pionen.
Zwischen 400MeV/c und 500MeV/c ist der Effekt etwa gleichgroß.
Die KAOS-Daten zeigen dagegen in allen Transversalimpulsbereichen eine
stärkere Emission der positiven Pionen senkrecht zur Reaktionsebene und
folgen damit der Voraussage des IQMD-Modells über die relative
Stärke.
-Detektors zeigen
bei Transversalimpulsen bis 400MeV/c
einen stärkeren ''Squeeze-Out'' Effekt für negative Pionen.
Zwischen 400MeV/c und 500MeV/c ist der Effekt etwa gleichgroß.
Die KAOS-Daten zeigen dagegen in allen Transversalimpulsbereichen eine
stärkere Emission der positiven Pionen senkrecht zur Reaktionsebene und
folgen damit der Voraussage des IQMD-Modells über die relative
Stärke.
Die in dieser Arbeit gezeigten Verteilungen bestätigen durch
die Übereinstimmung mit den Modellrechnungen die grundlegenden Annahmen
des Modells bezüglich der Mechanismen, die für die Flußeffekte
dert Baryonen und der Pionen verantwortlich sind..
Im Detail sind aber bei den Pionen
noch Abweichungen zu erkennen, deren Verständnis
weiterer Untersuchungen bedarf:
Das Flußverhalten der negativen Pionen ist als Funktion des
Transversalimpulses in den experimentellen Daten
ausgeprägter als im Modell. Auch ist die ![]() -Komponente für
positive Pionen in
peripheren Stößen in den experimentellen Daten schwächer als in den
Rechnungen. Dieses Verhalten widerspricht der Argumentation
mit der Coulomb-Wechselwirkung.
In zentralen Stößen wird im Modell für negative Pionen eine Fokussierung
in die Reaktionsebene vorausgesagt. Die Daten zeigen dagegen eine
positive
-Komponente für
positive Pionen in
peripheren Stößen in den experimentellen Daten schwächer als in den
Rechnungen. Dieses Verhalten widerspricht der Argumentation
mit der Coulomb-Wechselwirkung.
In zentralen Stößen wird im Modell für negative Pionen eine Fokussierung
in die Reaktionsebene vorausgesagt. Die Daten zeigen dagegen eine
positive ![]() -Komponente und damit eine sehr breite Verteilung.
-Komponente und damit eine sehr breite Verteilung.