Detektoren von der Komplexität des 4 ![]() -Detektors lassen sich ohne
Unterstützung durch Simulationen nicht mehr auswerten. Die große Zahl der
Kanäle, die auftretende hohe Teilchenmultiplizität und das Zusammenspiel
der Detektorkomponenten machen eine Auswertung unmöglich, wie sie für
Einzeldetektoren
gemacht werden könnte.
-Detektors lassen sich ohne
Unterstützung durch Simulationen nicht mehr auswerten. Die große Zahl der
Kanäle, die auftretende hohe Teilchenmultiplizität und das Zusammenspiel
der Detektorkomponenten machen eine Auswertung unmöglich, wie sie für
Einzeldetektoren
gemacht werden könnte.
Zur Simulation des Ansprechverhaltens des 4 ![]() -Detektors
werden vorgegebene
Teilchenverteilungen mit dem Simulationspaket GEANT [GEA93] durch
den Detektor propagiert. Das Resultat liegt im Format kalibrierter
Rohdaten vor und kann so mit derselben Analysesoftware wie die experimentellen
Daten bearbeitet werden. Auf diese Weise können auch gleich Fehler in dieser
Software aufgedeckt werden. Verwendet man theoretische Modelle als
Ereignisgeneratoren, verfügt man gleichzeitig über einen realistischen
Filter und kann nach der Analyse die Ergebnisse direkt miteinander
vergleichen.
-Detektors
werden vorgegebene
Teilchenverteilungen mit dem Simulationspaket GEANT [GEA93] durch
den Detektor propagiert. Das Resultat liegt im Format kalibrierter
Rohdaten vor und kann so mit derselben Analysesoftware wie die experimentellen
Daten bearbeitet werden. Auf diese Weise können auch gleich Fehler in dieser
Software aufgedeckt werden. Verwendet man theoretische Modelle als
Ereignisgeneratoren, verfügt man gleichzeitig über einen realistischen
Filter und kann nach der Analyse die Ergebnisse direkt miteinander
vergleichen.
Für Phase1 Experimente wurden solche Simulationen in [Sod94] für verschiedene Modelle durchgeführt. Weil bei diesem Experiment die Pionenproduktion im Vordergrund stand, wurde das IQMD-Modell [Har93] als Ereignisgenerator verwendet. Insbesondere sind die Effekte der Tracking-Programme auf die physikalischen Observablen von Interesse. Um den Einfluß der in Kapitel 2.6.1 beschriebenen Online-Datenreduktion mit zu berücksichtigen, werden mit der Simulation die Pulsformen generiert, wie sie auf den Zähldrähten vorliegen. Diese Pulse werden dann -- wie im Experiment durch die FADCs -- digitalisiert und dann mit denselben Reduktionsalgorithmen weiterverarbeitet. Bei diesem Schritt geht zwangsläufig die Information verloren, welcher Puls von welchem Teilchen stammt. Weil aber letztlich die rekonstruierten Spuren interessant sind, würde einem diese Information zwar bei der Optimierung der Algorithmen weiterhelfen, nicht aber bei der Interpretation der Ergebnisse. Die so erzeugten Hitverteilungen werden dann von den Tracking-Programmen genauso wie experimentelle Daten analysiert und die so rekonstruierten Observablen mit den Originalverteilungen verglichen.
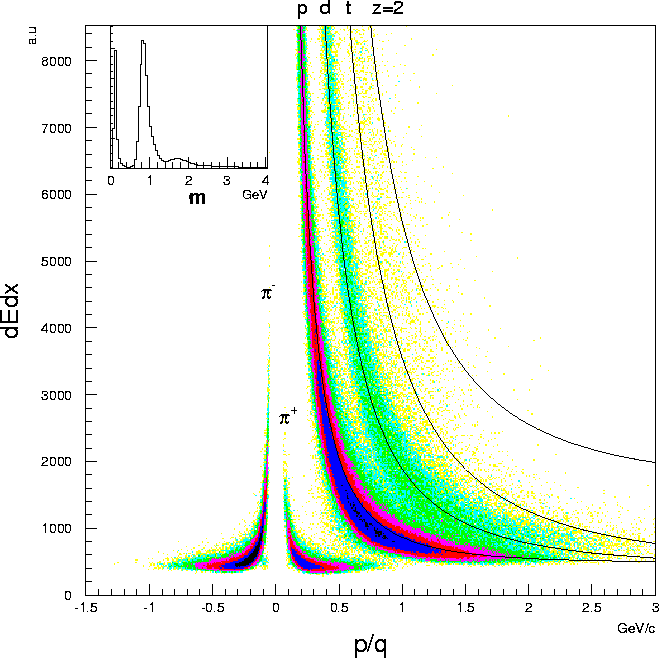
Abbildung:
Teilchenidentifikation für simulierte Ereignisse in der CDC: Aufgetragen
ist das Impuls zu
Ladungsverhältnis p/q gegen den über die Spur gemittelten
Energieverlust dEdx.
Die Linien sind die berechneten Energieverluste für die jeweiligen Teilchen,
die sich aus
angepaßten Bethe-Bloch Kurven nach Gleichung 2.1
ergeben. Oben ist die erreichte
Massenauflösung gezeigt.
In Abbildung 3.2 ist die mit dem Lokalen Tracking II erreichte Teilchenidentifikation für simulierte Ereignisse gezeigt. Der Verlauf der Teilchenäste stimmt qualitativ mit den experimentellen aus Abbildung 2.8 gut überein. Im Massenspektrum lassen sich aber schon signifikante Unterschiede bei den Multiplizitäten feststellen:
Auffällig ist die bessere Trennung der Teilchenäste bei den simulierten Daten. Dies läßt sich zum Teil auf die als Eingabe für die Simulationen verwendeten IQMD-Ereignisse zurückführen. Sie wurden mit einer realistischen Stoßparameterverteilung generiert, d.h. der Hauptanteil dieser Ereignisse stammt aus sehr peripheren Stößen mit einer geringen Teilchenmultiplizität. Im Experiment dagegen wurden durch den Trigger zentrale Stöße mit entsprechend höheren Teilchenmultiplizitäten bevorzugt.
Ein anderer Grund liegt darin, daß zwar die Auflösungen für die
Simulationen den experimentellen weitgehend angepaßt wurden, aber
systematische Verzerrungen
durch Detektoreinflüsse nicht
berücksichtigt wurden. So ist die durchschnittliche Zahl der Hits in der
Kammer bei vergleichbarer Spurmultiplizität in den simulierten Daten
signifikant größer. Außerdem ist die experimentelle z-Koordinate der Hits
(Koordinate in Strahlrichtung) erheblich schlechter, was sich direkt auf die
Impulsauflösung und damit die Breite der Teilchenäste auswirkt.
Auch Hits, die durch ![]() -Elektronen oder
Rauschen verursacht werden, gingen in die Simulation
nicht ein.
Die im folgenden extrahierten Effizienzen der
einzelnen Tracking-Programme zeigen daher eher, was unter
optimalen Bedingungen mit den verschiedenen Ansätzen erreichbar
wäre. Die Beeinflussung durch den Detektor muß dagegen noch
kritisch hinterfragt werden.
-Elektronen oder
Rauschen verursacht werden, gingen in die Simulation
nicht ein.
Die im folgenden extrahierten Effizienzen der
einzelnen Tracking-Programme zeigen daher eher, was unter
optimalen Bedingungen mit den verschiedenen Ansätzen erreichbar
wäre. Die Beeinflussung durch den Detektor muß dagegen noch
kritisch hinterfragt werden.